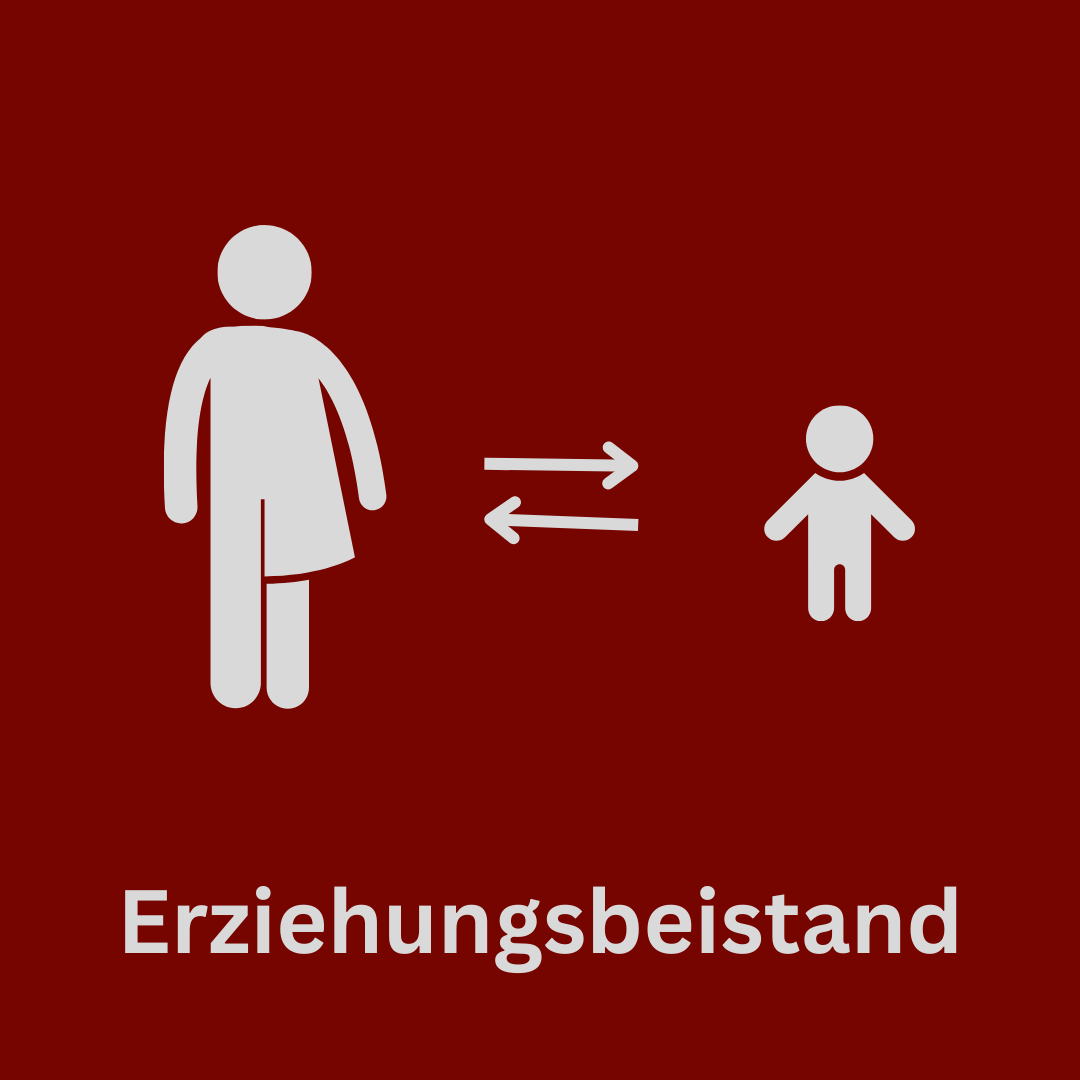Übersicht Freie Plätze
Aktuelle Stellenangebote

Freiwilligenes Engagement im Bundesfreiwilligendienst
Weiterlesen
Sozialpädagog*in, (m,w,d) in Tempelhof-Schöneberg
WeiterlesenUnsere Leistungen und Angebote
Sozialpädagogische Familienhilfe nach §31 SGB VIII
Die FamilienhelferInnen von AHB suchen die Familien in ihrem unmittelbaren Umfeld auf und unterstützen sie bei der Suche nach für die Familie passenden Lösungen und Wegen aus Krisen und Alltagsproblemen. Dabei werden die Familienmitglieder in der Wahrnehmung von eigenen Bedürfnissen unterstützt und sie erhalten die Möglichkeit, neues Verhalten und veränderte Kommunikationsformen im Alltag einzuüben. Die Familienhelfer leisten Beratung in Erziehungsfragen und fördern den Aufbau und die Pflege von Beziehungen.
Die Familie erhält Unterstützung:
- bei der Alltagsbewältigung
- in Erziehungsfragen
- im Abbau von Schwellenängsten z.B. gegenüber Ämtern und Beratungsstellen
- beim Aufbau konstruktiver Kommunikationsstrukturen und Konfliktlösungsstrategien
- beim Finden von Wegen aus der Isolation
Ziele der SPFH
Anhand von vorhandenen Ressourcen und durch die Mobilisierung der Familienkräfte, lernt die Familie hilfreiche Strategien zur Bewältigung ihrer spezifischen Schwierigkeiten zu entwickeln. Ziel der SPFH ist eine eigenverantwortliche Lebensführung und für die verschiedenen Familienmitglieder zufrieden stellende Lebensgestaltung, bei der die angemessene Versorgung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist.
Erziehungsbeistandschaft / Betreuungshilfe gem. § 30 SGB VIII
Dem Kind/Jugendlichen wird eine sozialpädagogische Fachkraft an die Seite gestellt, die auf Basis gemeinsam erarbeiteter Regeln für die Zusammenarbeit, eine langfristige, begleitende und beratende Hilfe zur Stützung und Förderung seiner Entwicklung anbietet und in Absprache wichtige Bezugspersonen (Eltern, LehrerInnen) einbezieht.
Das Kind/der Jugendliche erhält Unterstützung:
- bei der Entwicklung realistischer Schul-, Berufs- und Lebensperspektiven
- zur Förderung und Erweiterung seiner emotionalen und sozialen Kompetenzen
- zur gelingenden Integration in sein soziales und kulturelles Umfeld (Familie, Schule / Ausbildung, Freizeit)
Ziel der Unterstützung
Die Kinder und Jugendlichen werden bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen in ihrer Entwicklung gefördert und insbesondere Jugendliche bei der (Wieder-) Herstellung tragfähiger (Familien-) Beziehungen und beim Prozess der Verselbstständigung unterstützt.
Aufsuchende Familentherapie nach §27.3 SGB VIII
Aufsuchende Familientherapie ist eine therapeutische Hilfe und eine sehr effektive Methode, um chronifizierte Problemsituationen zu bearbeiten. Sie richtet sich häufig an Familien, mit schweren, oft chronifizierten Problemlagen und häufig negativen Erfahrungen mit diversen Hilfesystemen und die deswegen konsequenterweise Hilfe ablehnen. In der AFT geht neben der Arbeit mit dem Familiensystem auch darum, die Problemfixierung aller Beteiligten weitgehend aufzulösen und so den Zugang zu vorhandenen Ressourcen zu ermöglichen.
Ziel der Hilfe
Bewusstwerdung, Mobilisierung und Stärkung familiärer Kompetenzen und deren Nutzbarmachung für Krisensituationen, Entscheidungsfindungen und Veränderungsprozesse durch aktives Handeln, veränderte familiäre Kommunikation und die Nutzung vorhandener Ressourcen.
Therapeutisches Setting
Aufsuchende Familientherapie ist eine Form des Ambulanten Hilfeangebotes im Haushalt der Familie und wird im Team ausgeführt. Durch das primäre Zutrauen der Therapeuten in die Selbstwirksamkeitsfähigkeiten der Familie und durch klare und transparente Kommunikation wird zu Beginn der Therapie gemeinsam mit der Familie ein tragfähiges Arbeitsbündnis (auch im Zwangskontext) erarbeitet. Auf dessen Basis begeben sich die Therapeuten gemeinsam mit der Familie auf die Suche nach Handlungsmustern, Lösungserfahrungen und möglichen Zukunftsszenarien.
Begleiteter Umgang nach §18.3 SGB VIII
Mit dem Kindschaftsrechtreformgesetz traten am 1. Juli 1998 weitreichende Änderungen u.a. im BGB undSGB VIII in Kraft, die sowohl ehelichen, als auch Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ein eigenständiges Umgangsrecht, sowie eigene Ansprüche auf Beratung und Unterstützung durch den öffentlichen Träger und freien Trägern der Jugendhilfe einzuräumen.
Einsatzmöglichkeiten
Begleiteter Umgang kann sinnvoll sein, wenn
- die Kontaktanbahnung moderiert werden muss
- die Übergabe des Kindes vom Sorgeberechtigten/-verpflichteten zu übernehmen und zu begleiten ist
- zum Schutz des Kindes vor körperlicher oder seelischer Gefährdung
- die Gefahr der Kindesentführung besteht
- eine Rückführung des Kindes aus einer Pflegefamilie oder einer stationären Unterbringung beabsichtigt ist
- eine psychische Erkrankung der Umgangsberechtigten/-verpflichteten vorliegt
Ziele
Begleiteter Umgang dient als unterstützende, durch Beratung flankierte pädagogische Maßnahme der Ausübung des Umgangrechts, mit dem Ziel, die Umgangsgestaltung sobald wie möglich zu normalisieren.
Soziale Gruppenarbeit nach §29 SGB VIII
Die Soziale Gruppenarbeit ist ein Angebot im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Im Vordergrund steht das soziale Lernen in der Gruppe und die Elternarbeit. Die Gruppe dient als Lernfeld. Ziele und Lösungen werden mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam entwickelt, sie orientieren sich an deren spezifischen Lebensbedingungen, Fähigkeiten und Neigungen.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Stärkung des Selbstwertgefühls als Grundlage jeglicher Kommunikation und Interaktion im Vordergrund steht. Über die Unterstützung, die in der Gruppe erfahren wird, können sich die Kinder und Jugendlichen Erfolgserlebnisse erarbeiten, was zu einer Unterbrechung des Kreislaufs von Misserfolg, Frustration und Verweigerung führt. Positive Erfahrungen ermöglichen den Zugang zu den Kindern / Jugendlichen, die Realisierung der Ziele wird so erleichtert.
Inhaltliche Schwerpunkte
Stabilisierung des Selbstwertgefühls, auf dessen Grundlage soziales Verhalten erst möglich wird
Erhöhung der Frustrationstoleranz
Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen
Erleben eigener Verhaltensweisen im Kontakt mit Anderen
Erlernen alternativer Verhaltensweisen
Förderung der Fähigkeit, Konflikte zu lösen
Förderung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Unterstützung im schulischen Bereich
Familienanaloge Wohngruppen nach §34 SGB VIII
Familienanaloge Gruppenangebote sind eine Form der stationären Unterbringung als familienergänzende bzw. -ersetzende Hilfen für junge Menschen in besonderen Problemlagen. Eine Fachkraft lebt mit den Kindern in einem gemeinsamen Haushalt zusammen.
Familienanaloge Gruppenangebote haben in der Regel 2 - 3 Plätze für Kinder im Alter bei Aufnahme von 0 bis 8 Jahren. Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die langfristig außerhalb ihrer Herkunftsfamilie leben müssen, erhalten einen stabilen familiären Bezugsrahmen und die für ihre positive Entwicklung nötigen Bedingungen und Hilfe.
Ziele
Grundlage des pädagogischen Angebotes ist der stabile und zuverlässige familiäre Bezugsrahmen in Verbindung mit einem intensiven Beziehungsangebot. Neben der allgemeinen Grundversorgung des zu integrierenden Kindes/Jugendlichen bietet das familienanaloge Gruppenangebot den Rahmen für innerfamiliäre pädagogische Interventionen zum Abbau von Entwicklungs- und Erziehungsdefiziten.
Zielgruppe
- Aufgenommen werden können Kinder im Alter von 0 - 8 Jahren
Krisenwohngruppen nach §34 SGB VIII in Verbindung mit §42
Die zunehmende Anzahl von Kinderschutzfällen und die schwierige Situation, vor denen Kinder stehen, wenn sie plötzlich aus ihrer vertrauten häuslichen Umgebung herausgerissen werden, hat uns als Träger dazu bewogen Krisenwohngruppen aufzubauen.
Die Krisenwohngruppen verfügen über sechs oder mehr Plätze für Kinder im Alter von 0 – 8 Jahren. Die Unterbringung in einer Krisensituation ist in der Regel auf 3 bis höchstens 6 Monate begrenzt. In begründeten Einzelfällen kann der Zeitraum einmalig für weitere 6 Monate verlängert werden.
Die Einrichtungen bieten eine hohe Betreuungsdichte für Kinder im Säuglings- und Vorschulalter bzw. Grundschulalter. Gerade Kinder dieser Altersstufe bedürfen einer besonders intensiven und ansprechenden Betreuung im Falle einer Fremdunterbringung.
Die Einrichtungen gewährleisten eine effiziente und auf die Bedürfnisse der Kinder und deren Eltern und Geschwister abgestimmte Betreuung. Wie sich aus bindungstheoretischer Sicht zeigt, ist es dringend erforderlich, insbesondere bei Säuglingen, die Pflege und Betreuung mit möglichst wenig Wechsel der Beziehungspersonen fortzuführen. Aus diesem Grund wird in der Einrichtung mit dem Bezugsbetreuersystem gearbeitet.
Struktur und Angebote der Einrichtung
- Arbeit in der erzieherischen Betreuung in 24-Stunden-Diensten
- Tagsüber Verstärkung durch Sozialpädagog*innen, Leitung, Erzieher*innen
- Sicherstellung des weiteren Besuchs von Kita und Schule, ggf. Transport
- Elternaktivierende Maßnahmen und Beratungseinheiten in der Einrichtung bei einer geplanten Rückführung
- Bei Bedarf aufsuchende familientherapeutische Arbeit mit den Herkunfts-familien
- Bei Bedarf Kindertherapie (Einzel- und Gruppenangebote nach FLS)
- Bei Bedarf Familientherapie in Gruppen nach FLS
Wohngruppen mit Intensivleistung nach §34 SGB VIII
Intensivwohngruppen sind eine Form der stationären Unterbringung Hilfen mit hoher Betreuungsintensität für junge Menschen in besonderen Problemlagen und einem hohen Betreuungsbedarf. Die Leistungserbringung erfolgt hier im Schichtdienst.
Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die langfristig außerhalb ihrer Herkunftsfamilie leben müssen, erhalten ein Beziegungsangebot durch ein stabiles Team und die für ihre positive Entwicklung nötigen Bedingungen und Hilfen. In das Gruppenangebot mit Schichtdienst der vorliegenden Form des Trägers können bis zu fünf Kinder/Jugendliche ab sechs Jahren vermittelt werden.
Grundlage des pädagogischen Angebotes ist der stabile und zuverlässige familiäre Bezugsrahmen in Verbindung mit einem intensiven Beziehungsangebot. Neben der allgemeinen Grundversorgung des zu integrierenden Kindes/Jugendlichen bietet das familienanaloge Gruppenangebot den Rahmen für innerfamiliäre pädagogische Interventionen zum Abbau von Entwicklungs- und Erziehungsdefiziten.
Neben der Betreuung der Kinder bieten wir eine intensive Elternarbeit an, mit dem Ziel einer regelmäßigen Prüfung der Rückführoption in das Elternhaus. Besuchskontakte bleiben erhalten und können innerhalb sowie außerhalb der Einrichtung stattfinden.
Beratungsprojekt MaLi
MaLi ist ein flexibles Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Berliner Ortsteile Lichtenrade und Marienfelde. Unser Team besteht aus sozialpädagogischen Fachkräften mit langjähriger Berufserfahrung und verschiedenen Zusatzqualifikationen.
Die Homepage von MaLi mit allen aktuellen Informationen finden Sie unter mali-berlin.org
MaLi bietet psychosoziale Beratung und Begleitung für Familien, Paare und Einzelpersonen in schwierigen Lebenslagen, Konflikten oder Notlagen an. Bei kleinen wie großen Sorgen stehen wir Ihnen professionell zur Seite. Wir unterstützen Sie, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen, indem wir genau hinhören und mit Ihnen individuelle Antworten und Lösungswege finden.
Themen können beispielsweise Erziehungs- und Familienberatung, Ehe- und Lebensberatung bei Trennung, Scheidung, Konflikten, Einsamkeit, Ängsten und Depressionen sein. Aber auch Konflikte rund um die Kindererziehung, Schul-/ KiTa-Probleme, Stress in der Pubertät oder auch familiäre Veränderungen zählen dazu. Mit dem Thema Schuldistanz hat sich MaLi einen neuen Arbetisschwerpunkt gesetzt. Weitergehende Informationen finden Sie hier.
Familienrat
- Ziel: Eigenverantwortliche Lösungen finden (z. B. bei Erziehungsthemen, Trennung, Schule).
- Teilnehmer: Kernfamilie plus frei gewähltes soziales Umfeld.
- Ablauf: Information, Beratung durch Fachkräfte (optional), „Family-only“-Phase (Planung) und Beschlussfassung.
- Grundhaltung: Gleichwürdigkeit, Respekt und Stärkung der Autonomie.
- Vorteil: Nutzt persönliche Netzwerke statt nur professioneller Hilfe.